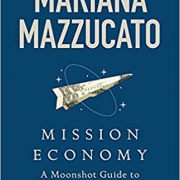Gestiegene Lebensmittelpreise – wer verdient eigentlich daran?
Seit 2020 haben sich Lebensmittel in Deutschland um rund ein Drittel verteuert. Das Einkaufen von Produkten des täglichen Bedarfs in Supermärkten ist deutlich kostspieliger geworden. Das belegt eine Analyse des Handelsblatt Research Instituts, das hierfür die Bilanzen von 70 mittelständischen und großen Markenherstellern sowie den führenden Handelskonzernen in Europa ausgewertet hat. Dabei wurde auch deutlich, wer der Nutznießer höherer Preise ist – und wer dabei verliert.
So beleuchtete das Handelsblatt am 16. September 2024 eingehend die Folgen der Inflation. Allein 2023 seien die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke laut Statistischem Bundesamt um 12,4 Prozent gestiegen – deutlich stärker als die allgemeine Teuerung. Die Zeitung konstatierte auf Basis der eigenen Analyse, dass nicht nur die Hersteller, sondern auch die Händler Gewinne einfahren. „Hersteller und Händler beschuldigen sich seit Jahren gegenseitig, die Preise in die Höhe zu treiben, um ihre Gewinne zu steigern“, schreibt die Zeitung. Tatsächlich profitierten beide in gleichem Maße.
Gestiegene Lebensmittelpreise: Gewinner sind vor allem die großen Produzenten sowie Handelsketten
Hinsichtlich der Produzenten gelte dies aber vorrangig für Konzerne – global agierende Markenartikler wie Nestlé (Kitkat), Unilever (Dove) oder AB Inbev (Beck’s) und Coca Cola. Die großen europäischen Handelsketten, darunter Rewe und Metro aus Deutschland, Tesco aus Großbritannien und Carrefour aus Frankreich, machten in ähnlichen Maße Gewinn, heißt es im Bericht.
Verlierer bei diesem Preisanstieg, der sich etwa mit Beginn der Coronapandemie durchsetzte, sind die Verbraucher, die tiefer in die Tasche greifen müssen. Prof. Dr. Hans-Christian Riekhof bewertet die Entwicklung aus Sicht des Pricing-Experten: „Es ist bemerkenswert, dass sowohl die Hersteller als auch die Händler die Phase stärkerer Inflation gleichermaßen nutzen konnten, um ihre Gewinne zu steigern. Man kann das als Indiz werten, dass beide Seiten den Prozess des Pricing recht gut beherrschen – allerdings zu Lasten des Verbrauchers.“
Pricing-Experte Riekhof: Beide Seiten haben den Prozess des Pricing verstanden – zu Lasten der Verbraucher
Neben den Verbrauchern gerät aber auch ein weiterer großer Verlierer in den Fokus: die mittelständischen Unternehmen, Produzenten mit weniger als einer Milliarde Euro Umsatz, beispielsweise Frosta und Weleda. Bemerkbar mache sich dies auch an steigenden Insolvenzzahlen von Konsumgüterfirmen. Laut Handelsblatt-Bericht können diese es sich nicht leisten, harte Preiskämpfe mit den großen Handelsketten auszufechten, schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Viele mittelständische Konsumgüterhersteller hätten in den Verhandlungen mit dem heimischen Handel eine schwächere Position, weil sie oft einen Großteil ihrer Erlöse in Deutschland erzielen und damit abhängiger von den vier großen Supermarktketten Aldi, Lidl, Edeka und Rewe seien.
Gestiegene Lebensmittelpreise: Mittlelständische Unternehmen legen weniger Wert auf Professionalisierung des Pricing
„Die Studie des Handelsblatt Research Institute verdeutlicht, dass den mittelständischen Herstellen einerseits die Marktmacht fehlt“, sagt Riekhof. „Andererseits wohl aber auch die Pricing-Kompetenz. Das zeigen zumindest unsere eigenen empirischen Studien: in den mittleren Unternehmen wird weniger Wert auf die Professionalisierung des Pricing gelegt.“
Wenn sich der Markt immer mehr konsolidiert, und darauf laufe es hinaus, würden Konzerne immer mächtiger, wird ein Konsumgüter-Hersteller zitiert. Und das sei auch keine gute Nachricht für die Händler. Wenn der Mittelstand auf Dauer ausblute, verliere der Handel die Vielseitigkeit seines Sortiments.